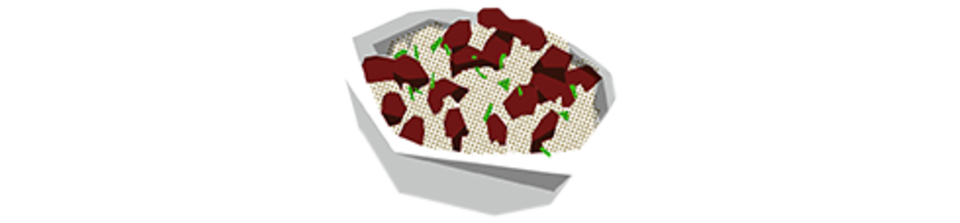Fotos: Sven Creutzmann
ANKUNFT IN HAVANNA
Von null auf hundert in null Sekunden: Der Taxifahrer kommt sofort zum Thema. Erst will er wissen, wo ich zu Hause bin. Hamburg, Germany. Er lacht. »Habt ihr dort den Burger erfunden?«, fragt er und erzählt, dass er Fast Food mag. Aber noch lieber Fisch. Überhaupt esse er sehr gern. Als wir uns dem Stadtzentrum nähern, sagt er: »Ist dir aufgefallen, wie klein viele jüngere Kubaner sind? Das liegt an der Mangelernährung während der Krise in den 90er Jahren.« Gleich mein erster, zufälliger Gesprächspartner in Kuba will übers Essen reden und spricht gleichzeitig die großen Probleme des Landes an. Vielleicht geht das eine auch nicht ohne das andere.
Es klang zunächst nach einer unsinnigen Idee, nach Kuba zu fahren, um etwas über gutes Essen zu erfahren. In meinem Reiseführer steht: »Die kubanische Küche ist nicht gerade für kulinarische Höhenflüge berühmt. (…) Kubas staatliche Restaurants haben keinen guten Ruf, die Bedienung ist oft langsam und das Essen bestenfalls unterer Durchschnitt. Trotz umfangreicher Speisekarten kommt auf den Tisch, was gerade da ist (meist Reis mit Huhn).«
Aber auch im heruntergewirtschafteten, mangelversorgten Karibikstaat kann man raffiniert und reichhaltig essen. Man muss staatliche Restaurants, die oft wirken wie eine Mischung aus Behörde und Autobahnraststätte, meiden und sich in familiären Pensionen und Privatrestaurants, den »Paladares«, bekochen lassen. Hier bekommt man das beste Essen, die größten Portionen, den herzlichsten Service und nebenbei einen Einblick in das Leben im real existierenden Sozialismus. In Kuba findet eine kulinarische Revolution statt, die vom Volk ausgeht.
In Berlin und San Francisco sind »Supper Clubs« sehr angesagt, halb öffentliche Dinnerabende, die Hobbyköche in ihren Privatwohnungen veranstalten. In Kuba existieren solche Wohnzimmerrestaurants bereits seit mehr als zwanzig Jahren. Man entdeckt dort überhaupt vieles, was bei uns gerade als Sharing-Economy gefeiert wird: Schon vor der Erfindung von Airbnb vermieteten Kubaner Zimmer ihrer Wohnung an Reisende, auch ohne Apps wie BlaBlaCar und Uber teilt man sich Transportmöglichkeiten. Einfach weil es nicht anders geht.
»No es fácil«, es ist nicht einfach, sagt der Taxifahrer zum Abschied, ein Satz, den ich auf der Reise noch oft hören werde; irgendwann verstehe ich, dass es sich um eine Art kubanisches Mantra handelt, mit dem die Inselbewohner ihren komplizierten Alltag bewältigen. »No es fácil« – das gilt, trotz verbesserter Versorgung, auch immer noch fürs Essen.
Eine Rundreise durch Kuba ist immer auch ein volkswirtschaftliches Seminar, in dem man lernt, auf welch fantasievolle Art und Weise die Menschen die Steine wegräumen, die ihnen von Regierung und Alltag in den Weg gelegt werden, mit genialen Ideen, sozialen Netzwerken, ganz ohne Internet.
TRINIDAD
Bevor ich in die Privatrestaurants von Havanna abtauche, fahre ich in die Provinz: Dreihundert Kilometer in Richtung Osten, nach Trinidad. Die fünfhundert Jahre alte Kolonialstadt gehört mit den bunten Häusern und palastartigen Villen, die vom vergangenen Reichtum der einstigen Zuckermetropole erzählen, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Eine Pflichtstation auf jeder Kuba-Reise, hier ist man auf Touristen eingestellt. In der Altstadt gibt es unzählige Casas Particulares, wie die privaten Minipensionen heißen.
Ich habe mich bei Yvon und Tony einquartiert, weil in den TripAdvisor-Bewertungen ihrer Unterkunft die Küche so gelobt wird. Das Mittvierziger-Ehepaar vermietet zwei Zimmer im ersten Stock, sie selbst bewohnen das Erdgeschoss, es gibt außerdem eine Dachterrasse mit einem kleinen Pool. Hier serviert Tony seine improvisierten Menüs – ich kann zwischen Fisch, Languste, Huhn und Schwein wählen.
Das Leben von Tony und Yvon macht zumindest nach außen nicht den Eindruck, als sei es von Mangel und Entbehrung geprägt – was für viele Kubaner gilt, die im Tourismussektor arbeiten und so Devisen verdienen (eine Übernachtung kostet etwa zwanzig Euro pro Nacht, das Drei-Gänge-Menü weitere zehn). Kuba hat zwei Währungen, den Peso Cubano (CUP) und den Peso Convertible (CUC), Ausländer zahlen in der Regel mit CUC. Die Devisen brauchen Kubaner für alle Waren, die über die absolute Grundversorgung hinausgehen – also für alle Dinge, die das Leben etwas angenehmer machen.
Kuba steht jedoch vor einer neuen Ära: Ende 2014 verhandelten Barack Obama und Raúl Castro über das Ende des Kalten Krieges in der Karibik, erstmals nach 55 Jahren gab es ein Gespräch zwischen den Staatsoberhäuptern der beiden Länder. Obama verkündete später, dass man diplomatische Beziehungen aufnehmen und den Handel erleichtern werde. Außerdem sollen mehr US-Bürger die Erlaubnis bekommen, nach Kuba zu reisen. Lange Zeit war ihnen das offiziell verboten. »Todos somos americanos«, sagte Obama in seiner Rede, wir sind alle Amerikaner, ein Satz für die Geschichtsbücher.
In Kuba jedenfalls ist man vorbereitet auf den Besuch der Nachbarn. Jenseits der staatseigenen Tourismusindustrie haben sich viele neue Kleinunternehmer etabliert – besonders in der Gastronomie.
Tony steht in der Küche und deckt einen Red-Snapper auf einem Blech mit einem Bananenblatt zu. Seine Schwägerin nimmt den Schnellkochtopf mit den schwarzen Bohnen, die in Kuba zu jedem Essen dazugehören, vom Herd. In der Küche ist es eng, Tony, ein herzlicher, laut lachender Typ, muss seinen Kugelbauch einziehen, um am Ofen vorbeizukommen. Während der Fisch gart, wirft Tony dünn geschnittene Bananenscheiben in eine große Pfanne mit siedendem Öl, fischt sie ein paar Momente später wieder heraus und fügt Salz hinzu. Ich darf naschen: Schmeckt besser als jeder Kartoffelchip. Der Salat mit Avocado, Tomate und geraspeltem Weißkohl steht vorbereitet auf der Arbeitsfläche. Der Reiskocher piept. Ein typisch kubanisches Essen ist fertig.
Später sitze ich auf der Dachterrasse in der Tropennacht und versuche zumindest die Hälfte der Riesenportion zu schaffen. Es ist lecker, aber auch: sehr viel und sehr fettig. Ich verstehe jetzt, warum kubanische Männer so große Bäuchehaben, die sie auf der Straße übrigens durch beiläufiges Hochrollen des T-Shirts präsentieren. Problemzonen definiert man in Kuba offenbar anders. Ein beliebter Anmachspruch lautet: »Si cocinas como caminas, me como hasta la raspa« – wenn du so kochst, wie du gehst, kratze ich auch den letzten Rest aus dem Topf.
Kuba liegt bekanntlich in der Karibik. Da überrascht es, dass die Küche für den deutschen Gaumen gar nicht besonders exotisch schmeckt. Ein Gericht besteht – wie in Schwaben oder in der Pfalz – aus einem Stück Fleisch mit Soße und Sättigungsbeilage. Allerdings gibt es statt Kartoffeln eben Reis und Bohnen, dazu kommen ein paar lokale Gemüsesorten, Wurzeln und Knollen wie Maniok, Yucca und Süßkartoffeln. Gewürzt wird mit Pfeffer, Kreuzkümmel, Zwiebeln und, ich kann das nicht genug betonen, unfassbar viel Knoblauch. »Kreolisch« nennt man die kubanische Küche auch, was bedeutet, dass sie sowohl spanische als auch afrikanische Einflüsse aufweist. Eines der bekanntesten kubanischen Gerichte heißt »Moros y Cristianos«, Mauren und Christen: weißer Reis mit schwarzen Bohnen, ein Multikultimenü.
Tony räumt meinen Teller ab, der noch halb voll ist, und ich überlege, wo er wohl die ganzen Zutaten aufgetrieben hat. Als ich am Nachmittag durch die Stadt gelaufen war, hatte ich nur trostlose Läden gesehen: leere, dunkle Räume mit kargen Tresen, dahinter ein paar Eierkartons und Säcke mit Reis und Bohnen, ein improvisierter Verkaufsstand für Kochschinken und Käse, selbst in den besseren Supermärkten, in denen man mit Devisen zahlen muss, waren viele Regale halb leer.
In einem großen deutschen Supermarkt stehen etwa 25 000 Artikel. Diese Auswahl macht uns, wie Psychologen in vielen Studien herausgefunden haben, jedoch nicht glücklich, sondern führt zu ziemlichem Stress: zwanzig verschiedene Sorten Erdbeerjoghurt = Entscheidungsüberlastung. In kubanischen Supermärkten hingegen steht eine einzige Sorte Dosentomaten – und an manchen Tagen gibt es gar keine Tomaten. Ist dann halt so. Das führt natürlich zu einer anderen, viel fundamentaleren Form von Stress.
»Laufen und finden«, antwortet meine Gastgeberin Yvon, als ich sie frage, wie sie denn unter diesen Bedingungen so wunderbare Menüs zusammenstellen könne. Dann erklärt sie mir das kubanische Versorgungssystem: Die dunklen Läden, die ich gesehen habe, sind staatliche Bodegas, wo die stark subventionierten und rationierten Grundnahrungsmittel verteilt werden. Jede Familie hat unabhängig vom Einkommen eine »libreta de abastecimiento«, ein Heftchen mit Lebensmittelmarken. Auch in den Bodegas gilt: Irgendwas fehlt immer. Mal gibt es tagelang keine Bananen, dann wiederum kann man nirgends Speiseöl auftreiben und muss es am nächsten Tag noch mal versuchen. Oder den Tag darauf. Das kostet Zeit, viele Familien leisten sich deshalb einen »mensajero«, einen Lieferanten, der mit den Bezugsheftchen mehrerer Nachbarn zur Bodega geht.
Ich fahre mit Yvon zum freien Markt, wo jeder das kaufen darf, was er sich leisten kann und was das Angebot eben so hergibt. Yvon kauft eine riesige Papaya sowie Yucca und Maniok. Dann hält plötzlich ein Auto am Marktstand, Kofferraum und Rückbank sind vollgepackt mit großen Zwiebeln, die der Fahrer nun verkauft. Yvon lässt sich ein paar einpacken, man weiß ja nie. Die restlichen Zutaten für das Abendessen hat sie im Haus. Wer in Kuba gut kochen will, muss gut planen können. Vorratshaltung ist wichtig – in der Küche von Tony und Yvon stehen zwei große Kühlschränke und ein riesenhafter Gefrierschrank, in dem Huhn, Fisch und Langusten lagern.
VIÑALES
Fünfhundert Kilometer westlich liegt das Dorf Viñales in einer von Landwirtschaft geprägten Region. Hier sieht man Bauern auf den Feldern, hört Hähne krähen und Schweine grunzen. Die Versorgungslage ist jedoch selbst in der Nähe der Erzeuger prekär.
Mein Gastgeber in Viñales heißt Jean-Pierre, 35 Jahre alt. Warum er einen französischen Namen hat, weiß er leider nicht, aber er gefällt ihm so gut, dass er seinen ersten Sohn ebenfalls Jean-Pierre genannt hat und seinen zweiten Jean-Luc. Er ist gelernter Koch und betreibt neben seiner kleinen Pension noch zwei Restaurants im Ort. »No es fácil«, sagt Jean-Pierre, es sei nicht einfach, die Gäste zu versorgen. Er erzählt, dass es vor einiger Zeit wochenlang kein Huhn gab – immerhin ein wichtiges Grundnahrungsmittel. Im Frühjahr 2014 war drei Monate lang auf der ganzen Insel kein kubanisches Bier zu bekommen – die staatliche Brauerei hatte kein Malz.
Ich begleite Jean-Pierres Frau Maibel zum staatlichen Markt am Ortsrand. Viel haben die gelangweilt wirkenden Verkäufer nicht im Angebot: Tomaten, Yucca, einen Schweinefuß. Maibel fragt nach Avocados. Gibt’s nicht. Wir fahren zum freien Markt in einer Seitenstraße: drei Holzkarren mit Obst und Gemüse, aber auch hier keine Avocados. Am Abend kocht Jean-Pierre mir Camarones, Süßwassergarnelen, in einer würzigen Tomatensoße. Dazu gibt es einen tollen Salat, in dem ich nun doch ein Stück Avocado finde. Maibel ist wohl noch mal losgelaufen, um welche zu finden. Vielleicht wusste die Nachbarin, wo es Avocados gibt, vielleicht hat sie ihr eine geliehen. In Kuba braucht man vor allem ein gutes Netzwerk. Man hilft sich, rückt zusammen, um das Leben meistern zu können. Und wenn man abends mit seinen Gastgebern zusammensitzt und ihre Geschichten hört und ihrem Alltag nahe ist, erlebt man tatsächlich den sozialen Mehrwert, von dem die Propheten der Sharing-Economy nur reden. »Wir wollen Menschen im echten Leben verbinden«, sagt zum Beispiel Airbnb-Mitgründer Brian Chesky in den Werbespots seiner Firma. In Kuba ist das halt kein kitschiger Lifestyle, sondern harter Alltag.
HAVANNA
In der Hauptstadt hat die kubanische Familienküche in den vergangenen Monaten einen enormen Professionalisierungsschub erlebt. An allen Ecken öffnen neue Paladares, privat betriebene Restaurants. Enrique, 46 Jahre, ein elegant gekleideter Typ mit zurückgekämmten Locken, betreibt Havannas berühmtesten Paladar, »La Guarida«, die Höhle.
In der Wohnung von Enriques Eltern wurde Anfang der 1990er Jahre der berühmte Film »Erdbeer und Schokolade« gedreht, der später sogar für einen Oscar nominiert war. In der Folgezeit klopften plötzlich dauernd Touristen an die Tür. Sie wollten »das Haus aus dem Film« sehen, das so typisch für Havanna ist: ein hundert Jahre alter Kolonialpalast, völlig heruntergekommen und doch von morbider Schönheit. Vor der Revolution lebte eine reiche Familie in dem Gebäude, später wurden immer mehr Zwischendecken und Wände eingezogen, um zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Heute wohnen dort mehrere Familien auf engem, verwinkeltem Raum zwischen bröckelndem Stuck, wackligen Marmortreppen und abenteuerlich zusammengeschusterten Elektroleitungen. Enrique nutzte das Interesse der Touristen und eröffnete in der Wohnung seiner Eltern ein Restaurant – mit großem Erfolg. An den Wänden des Lokals hängen Fotos der Prominenten, die schon bei ihm gegessen haben: das spanische Königspaar, Jack Nicholson, Javier Bardem, Steven Spielberg, Beyoncé und Jay-Z.
Enrique ist Unternehmer in einem sozialistischen Land. Er hat Geschäftssinn. Er hat große Ziele. Er hat es nicht einfach.
Erst in den 1990er Jahren wurden die Paladares, die zuvor mehr oder weniger im Verborgenen existiert hatten, offiziell erlaubt. Die Legalisierung war Teil der Maßnahmen während der »Período especial en tiempos de paz«, Sonderperiode in Friedenszeiten, wie diese Ära auch genannt wird. Nach dem damaligen Zusammenbruch des Ostblocks hatte Kuba plötzlich keine Unterstützer und Handelspartner mehr. Es fehlte beinahe an allem – vor allem an Energie. Weil die Sowjetunion kein Erdöl mehr lieferte, brachen Industrie und Landwirtschaft zusammen, die Menschen hatten nur noch wenige Stunden am Tag Strom, der Verkehr kam fast zum Erliegen, die Nahrungsmittel wurden knapp. Erst Ende der 1990er Jahre stabilisierte sich die Wirtschaftslage etwas, als der venezolanische Präsident Hugo Chávez Fidel Castro billiges Öl versprach.
Mit den Paladares sollten die Kubaner Eigeninitiative entwickeln und privatwirtschaftliches Wachstum generieren. Allerdings durften die Restaurants zunächst nur zwölf Plätze haben und nur Familienangehörige beschäftigen. Die Steuern waren hoch. »Es war so gut wie unmöglich, profitabel zu arbeiten und sich gleichzeitig an die Gesetze zu halten«, erzählt Enrique. 2009 schloss er sein Restaurant vorübergehend – zu wenig Gewinn, zu viel Arbeit und zu viel Ärger. Er ging nach Miami und überlegte, ganz dort zu bleiben. Doch seit drei Jahren hat La Guarida wieder geöffnet. Seit den Wirtschaftsreformen des neuen Präsidenten Raúl Castro ist privates Unternehmertum legal und auch die Paladares haben es leichter. Sie dürfen nun bis zu fünfzig Plätze haben und Personal anstellen.
KUBANISCHES KOCHBUCHCuba Libre sollte nicht das einzige Karibikrezept sein, das du beherrschst. Drei kubanische Klassiker (mit viel Knoblauch).
Moros y Cristianos
1 Tasse schwarze Bohnen mit 1 Teelöffel (TL) Oregano bissfest garen (im Schnellkochtopf circa 40 Minuten). Abgießen und das Kochwasser auffangen. 4 kleine Cachucha-Paprika oder 2 herkömmliche Paprika fein würfeln. Reichlich Knoblauchzehen (etwa eine halbe Knolle) mit Salz im Mörser zerreiben. In der Pfanne 1 gehackte Zwiebel und den Knoblauch in 2 Esslöffeln (EL) Öl anschmoren. Die Paprika und 1 TL gemahlenen Kreuzkümmel zugeben, vom Herd nehmen. 3 Tassen des Kochwassers in einen Topf gießen, die Bohnen und 3 Tassen Langkornreis zugeben. Pfanneninhalt zufügen, bei schwacher Hitze kochen, bis der Reis durch ist. Mit 1 EL Weinessig abschmecken.
Brathühnchen mit Knoblauch
2 Zwiebeln in Ringe schneiden. 8 Knoblauchzehen mit ½ TL Salz im Mörser zerreiben. Weitere 8 Knoblauchzehen halbieren. Ein küchenfertiges Huhn (circa 2 kg) in einer Kasserolle in Öl von allen Seiten
anbraten und dann die Hitze reduzieren. Die Zwiebeln braten, bis sie glasig werden, Knoblauch einrühren, 3 Lorbeerblätter, ½ Zimtstange,
1 Prise Kreuzkümmel, Salz und Pfeffer zugeben. 2 EL Weißweinessig, ½ Tasse Weißwein und ½ Tasse Rum zugeben und mit etwas braunem Zucker abrunden. Das Huhn etwa 90 Minuten braten, alle 30 Minuten wenden. Die Soße mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Ropa Vieja (»Alte Klamotten«)
700 g Rindersuppenfleisch, 3 klein geschnittene Selleriestangen, 2 halbierte weiße Zwiebeln, 3 Lorbeerblätter und 1 EL Salz im Topf mit Wasser bedecken und zugedeckt 90 Minuten köcheln lassen. Das Fleisch rausnehmen und kühl stellen. In der Pfanne 1 grob gehackte rote Zwiebel in 5 EL Olivenöl dünsten. 6 zerdrückte Knoblauchzehen eine Minute mitbraten. 6 in Streifen geschnittene Cachucha-Paprika (oder je 2 rote und grüne Paprika) zugeben, zugedeckt 10 Minuten dünsten. 4 entkernte, gewürfelte Tomaten, 1 TL Kreuzkümmel, Salz, Pfeffer und 2 EL weißen Rum zufügen. Zugedeckt 30 Minuten köcheln, abschmecken. Fleisch zerpflücken, in die Pfanne geben, zugedeckt heiß werden lassen. 10 Okraschoten in Essigwasser kurz blanchieren, in Streifen schneiden und in der Pfanne verrühren. Abschmecken und mit etwas gehackter Petersilie garnieren.
Aus: »Kubanisch kochen« von Birgit Kahle, Verlag Die Werkstatt. Alle Rezepte sind für vier Personen.
Gerade hat Enrique eine Bar auf der Dachterrasse eröffnet: sehr schick, sehr weiß, ganz anders als der Rest des Restaurants, das eher nach Großmutters Stube aussieht. In Havanna haben bereits mehrere Lokale in diesem Stil aufgemacht – als hätten die Kubaner geahnt, dass es vielleicht nicht mehr lange dauern würde, bis die US-Touristen kommen. Womöglich verschwindet sogar das Handelsembargo, das die USA nach der Revolution 1959 verhängt hatten. Obama sprach sich bei den jüngsten Verhandlungen dafür aus, es ganz aufzuheben, ob der US-Kongress ihm zustimmen wird, ist jedoch fraglich.
Natürlich würde der Massentourismus vieles von dem, was Kuba-Reisende bislang an dem maroden Land fasziniert, verändern. »Sobald es möglich ist, werden wir da unten sein«, sagt zum Beispiel ein Sprecher des Hilton-Konzerns. Wie viel Platz dann noch für Paladares, Casas Particulares und die vordigitale Sharing-Economy bleiben wird, weiß niemand.
Enrique läuft über die neue Wendeltreppe zu seiner Terrasse und sagt: »Dieses Haus ist so symbolträchtig. Man sieht hier Kubas reiche Vergangenheit, seine schwierige Gegenwart und nun eine mögliche Zukunft.« Es ist eine Zukunft, die weißer, glatter und vielleicht auch ein bisschen langweiliger sein wird, weil sie das Land an den großen Rest der Welt angleicht. Es ist aber auch eine Zukunft, die das Leben der Kubaner »más fácil« machen wird: einfacher.
Dieser Text ist in der Ausgabe 02/15 von NEON erschienen. Hier können Einzelhefte des NEON-Magazins nachbestellt werden. Alle Ausgaben seit September 2013 gibt es auch digital in der NEON-App.