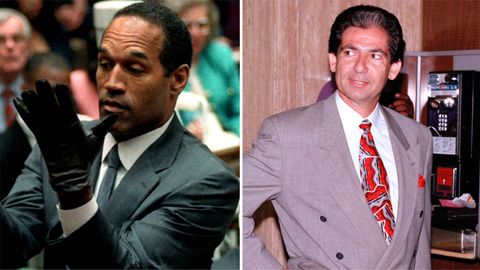Fotos: Michael Schmelling
Seit vier Stunden bin ich in Los Angeles und sitze in einem Friseursalon. Ich wollte hier nicht hin, es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Kurz vor der Abreise hatte ich mir in Hamburg noch ein paar Strähnen machen lassen, heller, sommerlicher, meine Friseurin war ganz aufgeregt gewesen: „L. A., toll, du wirst dort sicher die Zeit deines Lebens verbringen.“ Den Eindruck habe ich nicht. Seit dem Abflug in Frankfurt bin ich wahnsinnig gestresst, dabei ist bis jetzt eigentlich kaum etwas passiert. Ich bin zehn Stunden geflogen, habe statt des gebuchten Mietwagens in der Größenkategorie S ein Modell in Triple X bekommen, habe mir von Danielle, der Vermieterin meines Airbnb-Apartments in Venice, von der Zahlenkombination des Fahrradschlosses bis zur Bedienung der Waschmaschine alles erklären lassen, um mich dann total übermüdet auf die Suche nach einem Supermarkt zu machen. Ich irrte eine Weile herum, fand ihn nicht, und als ich dann mit einem Mal den Friseursalon sah, ging ich vor lauter Schreck hinein. Zwei Stunden an einem Ort, an dem ich die Abläufe im Griff habe? Ich bin bereit, viel Geld dafür zu zahlen.
Erstmal runterkommen
Was wir machen wollen, fragt die Friseurin und streicht mir etwas ratlos über den Ansatz, die Highlights seien ja ganz frisch. Ich weiß es leider auch nicht genau. „Vielleicht ein paar Lowlights?“, schlägt sie vor, und das, denke ich, heftig nickend, ist exakt das, was ich will. Bitte einmal alles runterschrauben.
„Dein erstes Mal in L. A.?“ – „Ja.“ – „Oh, toll! Du wirst die Zeit deines Lebens haben.“
Ich bin zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten von Amerika, und schon die Art, wie ich „Amerika“ ausspreche, verrät, dass ich keine Routine im Reisen habe. Amerika, mit starker Betonung auf dem „e“, Ameeerika, wie Kinder es sagen, die sich ein weit entferntes, abenteuerliches Land vorstellen. Und dabei ist es nur Amerika. Für eine gesunde, geistig aufgeschlossene Europäerin meines Alters ist es ja völlig normal, dauernd in den USA zu sein. Es ist, im Gegenteil, völlig unnormal, dass ich noch nie hier war. Und auch sonst fast nirgends.
Zurück im Apartment. Auf dem Bett liegend versuche ich des Jetlags wegen nicht zu schlafen. Ich schaue im Raum umher. Alles sehr freundlich hier, aufgeräumt, hell. Es ist still, ich höre mir selbst beim Atmen zu. Je mehr ich mich darauf konzentriere, desto fremder wird mir mein Körper. Er liegt einfach da, schwer, müde, völlig unbeeindruckt davon, an diesem fremden, weit von zu Hause entfernten Ort zu sein. Der Körper hat dem Kopf wirklich viel voraus.
Alleine reisen, alleine die Welt sehen
Durch die Bastrollläden fallen Lichtsplitter auf meine rechte Hand. Ich frage mich, ob es schöner wäre, wenn jetzt jemand neben mir läge, der sie hielte. Ankommen, duschen, auspacken, Selfies an Eltern und Freunde schicken, das ist schon sehr entspannt, so alleine. Trotzdem hatte ich es nie gewollt. Reisen, dachte ich immer, das mache ich, wenn ich einen Freund habe. Urlauben, also für ein paar Tage in irgendein Hotel an der Nordsee fahren und außer Lesen und Laufen nichts unternehmen, das geht auch so, alleine. Reisen aber, die Welt sehen, vielleicht ist das kein vorbildlich emanzipierter Gedanke, aber ich wollte das immer mit jemandem zusammen tun.
Am nächsten Morgen bin ich um 5.30 Uhr so weit fertig mit meinen Tageserledigungen und sitze komplett angezogen auf dem Bett. Ich bin aufgeregt. Draußen vor der Tür ist L. A. Und das Meer. Laut Google Maps muss ich zwanzig Minuten lang geradeaus laufen, ehe ich den Strand erreiche. Nach vierzig Minuten stehe ich endlich vor dem über die Straße gespannten Venice-Schriftzug. Foto machen. Noch eins. Noch eins. Hochladen auf Instagram. So. Und jetzt? Das blöde Unschlüssigkeitsrumstehen nach dem Post.
Der Strand ist ganz hübsch, der Rest der Gegend geradezu aggressiv versifft. Es gibt mehr Tauben als Möwen. Der Muscle Beach, das eingezäunte Freiluftfitnessstudio, ist noch leer. Auf der für seine Freaks berühmten Promenade überholt ein kleiner, stark trainierter Mann mit genervtem Gesichtsausdruck ein schlenderndes Paar. Er trägt einen Ghettoblaster und einen goldenen Tanga und muss in diesem Aufzug offenbar dringend irgendwohin.
Nur sehen, was man wirklich sehen will
Auf dem Rückweg versuche ich die sandfarbenen Gräser zu fotografieren, die aus vielen Vorgärten über den Bürgersteig wuchern. Die Fotos sehen langweilig aus. Ich denke, dass das vielleicht der größte Nachteil ist am Alleinereisen. Du kannst deinen Freunden ein Bild vom Venice-Schriftzug schicken und eins vom Strand. Aber jemandem zu erklären, dass man immer ganz nah an den Gartenzäunen entlangläuft, damit einen das so besonders weiche kalifornische Gras streift – unmöglich, klingt seltsam, lässt sich nicht teilen. Ist aber tatsächlich die schönste Erfahrung dieses ersten L. A.-Morgens.
Vor der Abreise hatte ich mir eine Liste gemacht mit Dingen, die ich unbedingt sehen will. Das Griffith Observatory, von dem man einen Blick über die ganze Stadt hat. Den Hollywood-Schriftzug. Einige Hotels, die ich aus Liedern, Büchern oder Erzählungen kenne. Ich will „Pretty Woman“-Orte abfahren. Die Wohnhäuser von Charles Bukowski. Das Elliott-Smith-Graffiti. Die Engelsflügelwand, vor der alle Bloggerinnen gerade ihre Outfitfotos machen. Den Kosmetikladen Sephora. Malibu. So gesehen vielleicht doch ganz gut, dass ich alleine bin. Ich kenne niemanden, der diese Orte in der Kombination als Sehenswürdigkeiten auffassen würde. Dafür muss ich im Gegenzug den ganzen anderen Quatsch nicht mitmachen. Ich werde mir zum Beispiel auf keinen Fall den Walk of Fame anschauen, diese begehbare Pressemitteilung. Für mich ist das ein ProSieben-Ort, in meiner Vorstellung steht dort jeden Tag Steven Gätjen und nimmt irgendeine Red-Carpet-Moderation auf, und wenn er fertig ist, kommen die aktuellen Kandidatinnen von „Germany’s Next Topmodel“ und wooohooohen sich die Seele aus dem Leib, weil sie in den Fußabtretersternen den Beweis dafür sehen, endlich in der großen, weiten Welt angekommen zu sein.
Das Schönste an L.A.: Auto fahren
Es ist June Gloom. Das heißt, bis mittags ist der Himmel meist wolkenverhangen, ab circa ein Uhr reißt er schlagartig auf. Die Sonne grellt dann von einem so spiegelglatten Blau herab, dass das Karosserieglitzern der Autos darin zu reflektieren scheint. Helligkeitspingpong zwischen Himmel und Erde, von allen Seiten strahlt und flirrt es, man wird fast verrückt vor Witterungsoptimismus. Überhaupt, das Tollste in L. A., da lege ich mich sehr früh fest, ist: Auto fahren. Es macht wahnsinnig viel Spaß, einfach nur stundenlang durch diese Kulissenstadt zu fahren und all ihre Gute-Laune-Requisiten zu betrachten: die Werbetafelplantagen, den Plattencoverhimmel, die wippenden Palmen. Dass sich der Verkehr dauernd staut und man eigentlich nie schneller als 45 Meilen fahren kann, macht die Sache nur noch besser. Hollywood, durch das ich gerade stop-and-goe, sieht aus wie eine überdimensionale verspiegelte Ray-Ban-Sonnenbrille. Alles ist gleißend schön, aber irgendwie erkennt man nicht, was sich dahinter verbirgt. Bis man einsieht, dass das eigentlich total egal ist.
Trotzdem ist Los Angeles auch anstrengend, weil es für mich als Touristin eine Stadt auf der Metaebene ist. Was man hier alles nicht denken darf, weil es schon zu oft gedacht wurde. Ein Freund hatte mir die Aussicht vom Griffith Observatory so beschrieben: „Du schaust zu einer Seite und sagst: ‚Wow, bis zum Horizont nur Stadt, irre.‘ Und dann schaust du zur anderen und sagst: ‚Gibt’s ja nicht, hier auch, bis zum Horizont.‘ In allen Himmelsrichtungen siehst du nur Los Angeles.“ Ein anderer bat mich, auf keinen Fall diesen Satz zu schreiben: „Los Angeles hat kein Zentrum.“ Das sei halt so, da müsse man langsam mal drüber wegkommen. Es ist mein dritter Tag hier, ich habe eineinhalb Stunden bis zum Mount Lee gebraucht und dann noch mal fünfzehn Minuten zu Fuß, ich stehe auf dem obersten Punkt der Aussichtsplattform und bin sehr weit davon entfernt, über die Ausmaße dieser Stadt hinwegzukommen. Wirklich, bis zum Horizont.
Muss man Schönes zwangsläufig teilen?
Das muss man fotografieren. Dreimal versuche ich, mein Handy an einer Säule abzustützen, um mit der Selbstauslöserfunktion ein Foto für meine Eltern zu machen. Zweimal fällt es um, einmal teile ich mir das Bild mit einer asiatischen Touristengruppe, und als ich endlich meine, den richtigen Winkel gefunden zu haben, ist der Akku leer.
Augenblicklich vergeht mir der Spaß. Ich sehe und höre jetzt nur noch Gruppen, Familien, Paare, die sich gegenseitig auf das, was sie sehen, aufmerksam machen. Sie alle sind voll da. Ich nicht. Obwohl es nichts gibt, was mich ablenkt, kann ich die Aussicht nicht genießen. Angeblich ist Reisen ja Leben im Augenblick. Aber irgendwie funktioniert das nur, wenn man sich den Augenblick und dessen Schönheit dauernd gegenseitig bestätigt. Schau, wie schön es ist! Guck mal, die Sonne! Sieh nur, das Meer! Man muss es sich erzählen, es bedeutet sonst nichts.
In den folgenden Tagen vermeide ich Allumfassungsschauplätze wie das Observatorium. Ich denke mir Mottoausflüge aus: fahre an einem Tag alle Schriftstellerbiografieorte ab, die mir einfallen, und besuche am nächsten nur jene Hotels, in denen ein Freund mir „rumzustreunen“ empfohlen hatte. Ich trinke eine Diet Coke im Sunset Marquis, dessen Postanschrift „1200 Alta Loma“ klingt wie ein Albumtitel und in dessen Keller es tatsächlich ein Tonstudio gibt, in dem Aretha Franklin und Elton John Songs aufgenommen haben; ich esse einen 38-Dollar-Salat in der Polo Lounge des Beverly Hills Hotel, spaziere durch die Empfangshalle des „Pretty Woman“-Drehorts Beverly Wilshire, trinke Limetten-Soda auf der Dachterrasse des Ace. In den Hotelbars und Gärten ist das Alleinsein okay, hier falle ich nicht weiter auf und fühle mich nicht auffallend.
L.A. ist ein einziges, großes Popzitat
In den Restaurants ist es unangenehmer. Ich habe das Gefühl, die Angestellten unterhalten sich aus Mitleid länger mit mir als mit den anderen Gästen. Besonders Tom, der Kellner aus dem Beverly Hills, ist sehr zugewandt, erkundigt sich ausführlich nach Details meiner Reise. Als er irgendwann fragt, ob die Kombination aus Kleid und Nagellack modisches Kalkül oder bloß ein „happy accident“ sei, versuche ich ihm klarzumachen, dass es mir gut gehe und ich gar nicht so einsam sei, wie es vielleicht wirke. Mehrere Minuten rede ich mich in meinem Behelfsenglisch in Rage, Tom lächelt höflich, sagt „sicher“ und „ja, klar“ und als er ein bisschen zu ernst nickend meine Cola nachgießt, wird mir klar, dass es Tom in Wahrheit vermutlich scheißegal ist, wie alleine ich mich fühle, er arbeitet einfach nur in einem an Servicehöflichkeit kaum zu überbietenden Fünfsternehotel.
In der zweiten Hälfte meiner Reise stelle ich das Neue-Eindrücke-Sammeln ein. Ich fahre ab jetzt nur noch zu denselben Orten, einfach weil es mir dort gefällt: zum Hollywood Sign am Mulholland Drive, Zuma Beach in Malibu, Westhollywood, die Einkaufsstraße Abbot Kinney in Venice. Sie erzeugen erste Pauschalgefühle: Ich liebe es, am frühen Morgen in den Hollywood Hills herumzulaufen. Ich mag die kalifornische Körperlichkeit, dass die Menschen einem noch am Strand anerkennend zurufen: „Toll, dass du was für deine Bräune tust!“ Dass man an einem Abend das halbe „Unter Null“ von Bret Easton Ellis abfahren kann. Überhaupt: dass L. A. ein einziges großes Popzitat ist, in dem man umherspazieren kann. Es ist, als würde man einen Filmstar treffen und eben nicht als Erstes denken: „Der ist aber kleiner als im Fernsehen.“
An meinem letzten Nachmittag fahre ich von Venice an der Küste entlang zum Leo Carrillo Beach in Malibu. Ich habe mich gerade auf meinem Badehandtuch eingerichtet, als sich ein Schatten in der Größe eines Medizinballs über meine Beine legt. Ein Vogel fliegt knapp über mich hinweg, ich bilde mir ein, seine Flügelschläge zu spüren. Er steuert auf die Brandung zu, dreht dann ab und gleitet langsam über die Felsen davon. Was war das denn? Die Google-Recherche nickt meiner Vermutung zu: ein Pelikan. Für den Pelikan, lese ich, ist das Abheben eine strapaziöse Angelegenheit. Sein Körper kann sich nur schwer aufraffen, er muss eine lange Strecke flügelschlagend auf der Wasseroberfläche laufen, ehe er sich in die Luft erheben kann. Dann aber ist er ein ausdauernder Flieger, der bis zu 500 Kilometer am Stück zurücklegt. Der Pelikan scheut den Aufbruch, aber er liebt die Reise.
Und dann plötzlich ganz viel Einsamkeit
Drei Stunden liege ich noch am Strand, denke über den Pelikan nach und die vergangenen Tage, der Nachmittag plätschert dem Abend entgegen, die meisten Familien sind dabei, ihre Sachen und Kinder zusammenzusuchen, als in meinem Ohr plötzlich Weihnachtsglöckchen läuten. Die Playlist meines Smartphones spielt Mariah Careys „All I Want For Christmas“.
Ich hatte damit gerechnet, ich hatte mich eigentlich die ganze Reise über gefragt, wann dieser Moment kommen würde: Es erwischt mich voll. Die verlässlichste, härteste Art Liebeskummer ist immer noch die unbestimmte, ins Nichts laufende, sich nicht mal mehr an eine bestimmte Person richtende, sondern nur noch an das Gefühl als solches. Mir schießen Tränen in die Augen, ich presse den Mund gegen die angezogenen Knie. Allein sein, frei sein – schön und gut. Aber eben auch überhaupt nicht.
Die Playlist läuft weiter, Blackstreet – „No Diggity“, wahnsinnig unpassend und eine große Rettung, und ich denke, dass diese banale Theorie, die ich immer schon hatte, tatsächlich stimmt: Die Welt ist groß, aber das Herz bleibt klein in seinen Regungen. Ich summe hier dieselben Lieder wie zu Hause, zitiere dieselben Schriftsteller, vermisse dieselben Menschen. Sich selbst in der Ferne näherkommen? Vielleicht. Auf jeden Fall aber dem, was man liebt.
Alleine reisen, alleine ankommen
Ich glaube, es ist gar nicht das Paarreisen, das man romantisieren muss. Das Reisen als Paar oder mit Freunden hat seinen Sinn schon in der Verbindung zueinander, komm, reich mir die Hand, wir wollen uns die Welt anschauen. Da ist es dann auch egal, welcher Fleck der Welt genau das ist. Wer alleine verreist, ist gezwungen, den Ort, zu dem er fährt, aufzuladen mit sich selbst, mit seiner Sehnsucht oder seiner Angst oder der Suche nach Spaß. Er muss Romantiker sein und darf sich dafür nicht schämen. Sonst ist es wirklich Segway-Sightseeing, Walk-of-Fame-Tourismus, Hollywood-Trash.
Der Alleinreisende muss sich in einem Pelikan wiederfinden können oder im Garten des Sunset Marquis oder in dem Moment, als das Autoradio am letzten Abend Nat King Coles „Unforgettable“ spielt. Er kann dann, auf dem Weg zum Flughafen, vorbei an verwahrlosten Einkaufswagen, Palmen und den vielleicht verheißungsvollsten Straßennamenschildern der Welt den alten Jörg-Fauser-Satz denken, der ab jetzt ein bisschen stimmt: „Und immer ist irgendwo L. A.“
Der einsamste Moment meiner Reise ist der, als ich am Hamburger Flughafen ankomme und niemand auf mich wartet.
Play L. A.
Los Angeles ist ein großes Popzitat. Unsere Autorin teilt ihre persönliche Reiseplaylist auf www.neon.de/singmeinesongs
Dieser Text ist in der Ausgabe 08/2016 von NEON erschienen. Hier können Einzelhefte nachbestellt werden. NEON gibt es auch als eMagazine für iOS & Android. Auf Blendle könnt ihr die Artikel außerdem einzeln kaufen. Alle Beiträge des Leben-nach-der-Liebe-Dossiers findet ihr hier.